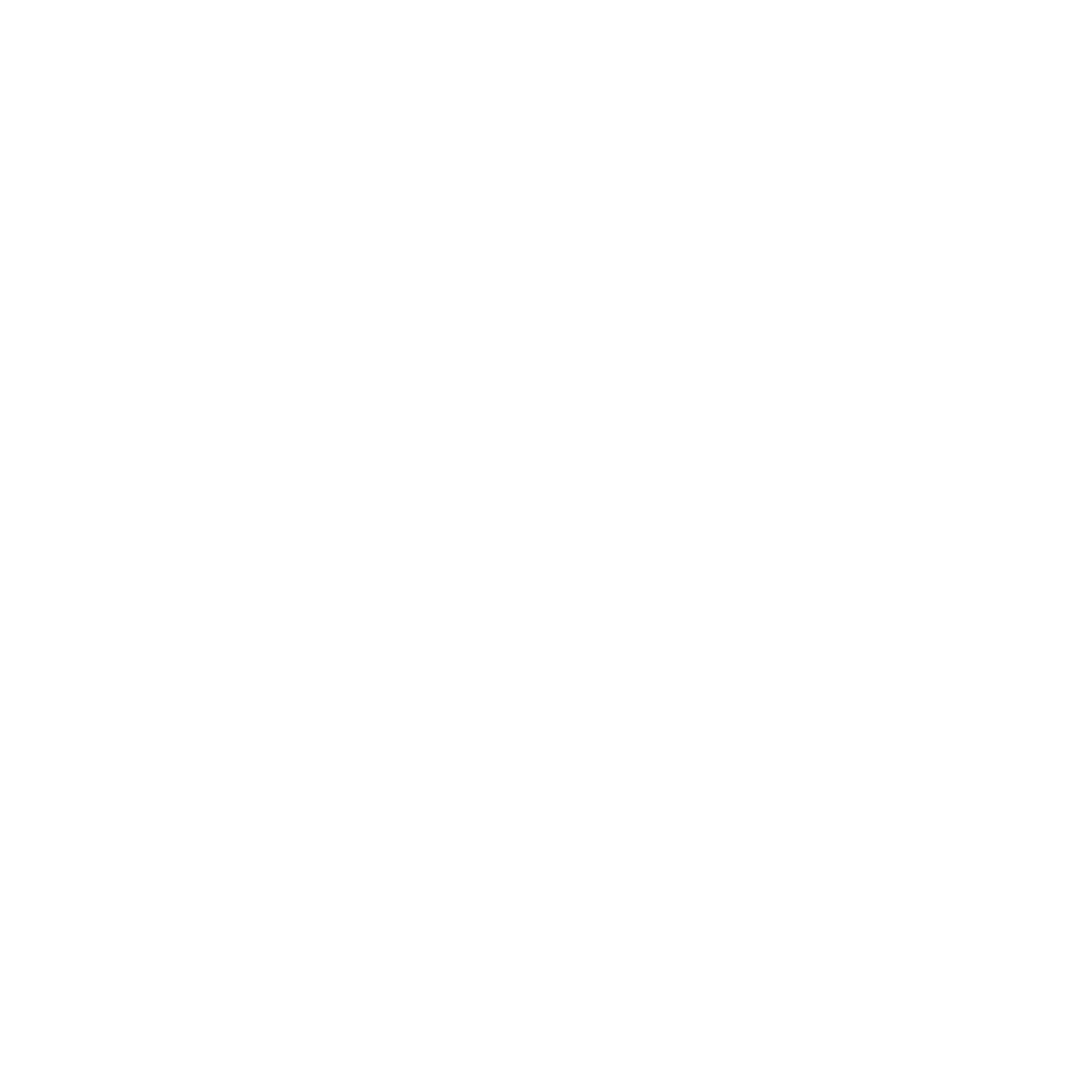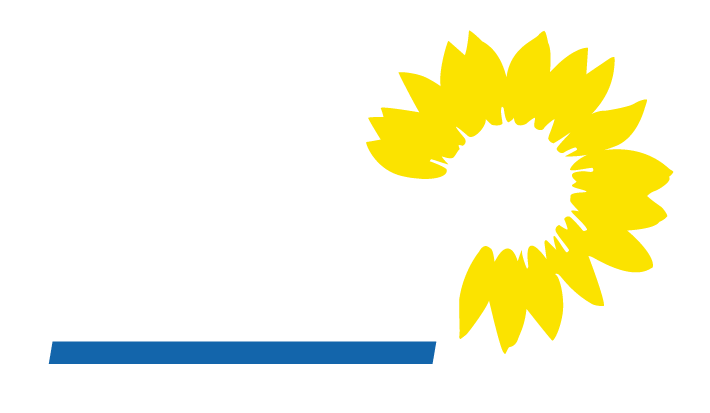
Politische Informationsfahrten
Stefan Wenzel: Gute Möglichkeit, um sich über Politik zu informieren
Jede und jeder Bundestagsabgeordnete hat die Möglichkeit, dreimal im Jahr Besuchergruppen nach Berlin einzuladen. Organsiert werden diese Fahrten vom Bundespresseamt zusammen mit den Wahlkreis-Büros der Abgeordneten. Enthalten sind die Bahnfahrt, die Hotelübernachtung im Doppelzimmer, Frühstück und zwei Mahlzeiten in einem Restaurant. „Wir haben in den letzten zwei Jahren bereits sieben Fahrten mit politisch Interessierten durchgeführt und viel positives Feedback bekommen“ so der Grüne Bundestagsabgeordnete aus Cuxhaven. Und weiter führt Wenzel aus: „Ich möchte jede und jeden ermutigen, einmal an einer solchen Fahrt teilzunehmen. Zusammen mit dem Bundespresseamt plant mein Wahlkreis-Büro ein tolles Programm rund um das politische und geschichtliche Berlin. In Zeiten, in denen wir vermehrt mit Fake News konfrontiert sind, ist es wichtig, sich aus erster Hand zu informieren.“
Ausdrücklich seien diese Fahrten keine Parteiveranstaltungen, sondern sollen einen neutralen Einblick in die Arbeit des Bundestages vermitteln.
Die erste Fahrt im Jahr 2024 findet vom 16. bis 18. Januar statt. Verbindliche Anmeldungen für diese Fahrt nimmt das Wahlkreis-Büro bis zum 19. Dezember entgegen. Interessierte können sich unter stefan-wenzel.de informieren und sich über das Anmeldeformular auf der Homepage für die Fahrt anmelden.
Pressekontakt:
Jana Wanzek
Mail: stefan.wenzel.wk@bundestag.de
Tel.: 0171 1086242
Wahlkreisbüro von Stefan Wenzel
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Internet: www.stefan-wenzel.de
Weg frei für eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung
Bundestag verabschiedet Gesetz für die Wärmeplanung – Wichtiger Beitrag zur Planungs- und Investitionssicherheit für Länder, Kommunen und Energieversorger
Der Deutsche Bundestag hat heute das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) verabschiedet. Er schafft damit eine wesentliche Grundlage für eine klimafreundliche und bezahlbare Wärmeversorgung in Deutschland, die dazu beiträgt die Klimaziele im Jahr 2045 einzuhalten.
Ziel des Wärmeplanungsgesetzes ist es, die Planungs- und Investitionssicherheit der Akteure vor Ort zu verbessern und die Entwicklung der Wärmeversorgung und Energieinfrastrukturen zu steuern. Das Wärmeplanungsgesetz sieht dazu eine Verpflichtung der Länder vor, Wärmeplanungen durchzuführen. Die Länder können diese Aufgabe auf die Kommunen übertragen. Kernstück der Wärmeplanung ist die Ausweisung von Wärmeversorgungsgebieten. Dabei wird dargestellt, welche Wärmeversorgungsart für ein Gemeindegebiet besonders geeignet ist. Die Ausweisung erfolgt auf Basis einer Bestandsanalyse, mit der die bestehende Wärmeversorgung ermittelt wird, sowie einer Potenzialanalyse.
Das Wärmeplanungsgesetz soll gemeinsam mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Neben der Wärmeplanung legt das Gesetz Anforderungen an den Einsatz von erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwärme in Wärmenetzen fest. Bis zum Jahr 2030 müssen Wärmenetze zu einem Anteil von 30 Prozent und bis 2040 zu einem Anteil von 80 Prozent aus erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist werden. Neue Wärmenetze müssen bereits ab dem 01. März 2025 einen Anteil von 65 Prozent aufweisen.
Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen:
"Wir sind jetzt wieder einen großen Schritt weitergekommen. Mit diesem Gesetz wissen die Kommunen, die Unternehmen, die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Mieterinnen und Mieter in Zukunft, welche Energieversorgung für sie in Frage kommt und welche Möglichkeiten es in ihrem Ort überhaupt gibt. Wird die Wärme aus Geothermie oder Biomasse, aus Windkraft, Photovoltaik oder Abwärme erzeugt, kommt ein Fern- oder Nahwärmenetz in Frage? Auf all diese Frage gibt es Antworten, wenn Wärmepläne in den Kommunen aufgestellt werden. Dafür gibt es Zeit, kleine Gemeinden können sich bis Mitte 2028 dazu Gedanken machen.
Viele Kommunen haben sich bereits auf den Weg gemacht, in einigen Bundesländern ist die Wärmeplanung verpflichtend. Auch sind grenzüberschreitende Wärmeplanungen möglich, in den deutsch-polnischen und deutsch-französischen Grenzgebieten wird gemeinsam geplant. Das Gesetz lässt viele Wege und Möglichkeiten zu.
Ich bedanke mich bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages für ihre engagierte Arbeit und dafür, dass sie dieses Gesetz ermöglicht haben.“
Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz:
„Städte und Gemeinden erhalten nun ein Instrument, mit dem sie ihre Wärmeversorgung in eigener Hoheit entwickeln, ausbauen und schrittweise auf erneuerbare Energien umstellen können. Das schafft Klarheit und Planungssicherheit. Der Ausbau der Wärmenetze kann auf unterschiedliche Weise geschehen, je nach dem, was sich vor Ort am besten anbietet, also wirtschaftlich und effizient ist: zum Beispiel mit Geothermie, Abwasserwärme oder der Umweltwärme, die sich durch Wärmepumpen, zunehmend auch durch Großwärmepumpen, in die Wärmenetze einspeisen lässt. Das Gesetz stellt sicher, dass die Wärmenetze in Deutschland dabei immer sauberer und klimafreundlicher werden.“
Kurzüberblick zum Gesetz:
• Kern des Wärmeplanungsgesetzes ist die Verpflichtung der Länder, dafür zu sorgen, dass Kommunen Wärmepläne erstellen: bis zum 30.06.2026 für Großstädte und bis zum 30.06.2028 für Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern.
• Bereits aufgrund Landesrechts erstellte haben Bestandsschutz; für andere Wärmepläne gilt Bestandsschutz, wenn die dem Wärmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes im Wesentlichen vergleichbar ist.
• Die Wärmeplanung ist technologieoffen. Die Akteure vor Ort ermitteln und entscheiden über die wirtschaftlichste und effizienteste Wärmeversorgungsart. Dies kann eine leitungsgebundene Versorgung mittels Wärmenetz oder mit klimaneutralen Gasen oder eine dezentrale Wärmeversorgung, beispielsweise mittels Wärmepumpe, sein.
• Das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz sind aufeinander abgestimmt. Dazu zählt auch die Möglichkeit, die 65 Prozent-Vorgabe für Bestandsgebäude im Sinne des Gebäudeenergiegesetzes in zeitlicher Hinsicht vorzuziehen, wenn die zuständige Stelle dies entscheidet.
• Ergänzend zum Wärmeplanungsgesetz erfolgen Änderungen des Baugesetzbuchs, die die bauplanungsrechtliche Umsetzung der Wärmeplanung unterstützen, sowie eine Anpassung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
Stefan Wenzel - unser Bundestagsabgeordneter
Seit 2021 ist Stefan Wenzel im Bundestag, er ist der grüne Abgeordnete aus dem Wahlkreis Cuxhaven/Stade II - erstmals ein grüner Bundestagsabgeordnete aus unserem Wahlkreis.
Stefan Wenzel ist Mitglied im "Ausschuss für Umwelt,Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz". - Im "Haushaltsauschuss" sowie im Ausschuss für "Klimaschutz und Energie" ist er stellvertretendes Mitglied. Seit Juli 2022 ist Stefan Wenzel Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz.
weitere Infos auf der Internetseite der Bundestagsfraktion
Stefan Wenzel, von 2013 bis 2017 Umweltminister in Niedersachsen kandidierte in der Bundestagswahl in unserem Wahlkreis und wurde über die Landesliste in den Bundestag gewählt. Sein Wohnsitz ist in Cuxhaven, dort ist er mit einem Wahlkreisbüro in der Deichstraße 4 vertreten. Seine Mitarbeitende vor Ort ist Jana Wanzek . Das Wahlkreisbüro ist jeden Dienstag und Mittwoch zwischen 9:00 und 16:00 Uhr besetzt (Gesprächstermine nach Absprache). Mail: Stefan.Wenzel.wk@bundestag.de
Wenzel erfreut über Bundesförderung für Gewässerschutzprojekt
Foto: Gruene-Cux
„Alpha-E“ ist Nachteil für Bremen und Nordwestniedersachsen!
Newsletter 7
Newsletter Nr. 6
Stefan Wenzel (MdB): Äußerungen zu A 20 ohne Substanz, Susanne Menge (MdB): Ausbau des Autobahnnetzes nicht mit Klimaschutzzielen vereinbar
... gesehen in der Bonner Verkehrsausstellung
Berlinfahrt
Bundesregierung / StadtLandMensch-Fotografie
Cuxhavener Grünen-Politiker Wenzel für Ständige Kommission Elbe mit Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen
Newsletter Nr. 5
Cuxhavener Grünen-Politiker Wenzel: Norddeutsche Länderchefs sollen auf Neuwerk Dauerstreit über das Ausbaggern der Elbe zu einem Ende bringen
Für die Einrichtung eines Schutzgebietes im Weddellmeer der Antarktis
„Offenbarungseid bei der Elbvertiefung“
Stefan Wenzel gibt Tipps im Energiesparbuch: Zuhause Strom, Gas, Wasser und EURO sparen – Jeder Beitrag zählt!
Newsletter Nr. 4
Stefan Wenzel: Statement anlässlich der Teilnahme an der Veranstaltung zur Aufnahme des Regelbetriebs für Wasserstoffzüge im Elbe-Weser-Dreieck
„Etikettenschwindel bei A 20 beenden“ - Parlamentarischer Staatssekretär Stefan Wenzel: Wo Autobahn draufsteht, ist kein Klimaschutz drin – Hohe Belastungen durch Baukosten und Umweltschäden vermeiden
Cuxhavener Grünen-Abgeordneter Wenzel fordert Konsequenzen angesichts des bedrohlich wachsenden Sauerstoffmangels in der Elbe
Newsletter Nr. 3
Stefan Wenzel wird zum Parlamentarischen Staatssekretär ernannt
Stefan Wenzel: Beibehaltung der Behelfsbrücke bei Hechthausen. Stecke Cuxhaven - Stade braucht Zweigleisigkeit für mehr Tempo, mehr Kapazität und mehr Komfort
Cuxhavener Grünen-Bundestagsabgeordneter Wenzel: Haushaltsausschuss macht den Weg frei für zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Wattenmeerzentren - "Weiterer starker Impuls für den Schutz unseres Naturwunders Wattenmeer"
Mehr Unterstützung für Wattenmeerzentrum Cuxhaven
Versorgungssicherheit mit Gas in Europa schnell sicherstellen
Der Cuxhavener Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel zu den Plänen von Preußen Elektra zur Einleitung von radioaktiv belastetem Wasser in die Elbe
Neues Fährkonzept - überzeugender Plan für mehr umweltfreundliche Mobilität
Newsletter Nr. 2
Cuxhavener Grünen-Politiker Wenzel will Ex-Umweltministerin Hendricks als Vermittlerin im Streit um Deponierung von Hamburger Hafenschlick: Ausgewiesene Kennerin von Umwelt und Naturschutz – Für Ausgleich von Ökologie und Ökonomie
Vorschlag: Hendricks als Vermittlerin
Grünen-Politiker Wenzel kritisiert Beginn der Deponierung von belastetem Hamburger Hafenschlick bei Scharhörn: Rücksichtslos und rechtswidrig!
Hamburger Schlickpläne provozieren Grundsatzstreit – Wenzel: Gehört Neuwerk rechtlich einwandfrei zur Hansestadt? – Staatsvertrag von 1961 soll überprüft werden
Der Cuxhavener Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Wenzel will die Rechtmäßigkeit des Hamburger Besitztums an der Nordseeinsel Neuwerk und dem umliegenden Gebiet neu prüfen lassen. Im Zusammenhang mit dem sich zuspitzenden Streit zwischen der Hansestadt und den Gemeinden an der Unterelbe über die geplante Verklappung von Hafenschlick bei Scharhörn sieht der Grünen-Politiker staatsrechtlichen Klärungsbedarf“.
„Die Rücksichtslosigkeit der Hamburger provoziert einen Grundsatzstreit. Wenn die Hansestadt im betreffenden Gebiet eine Schlickdeponie einrichten will und für sich das alleinige Entscheidungsrecht reklamiert, stellen wir in Frage, ob Neuwerk überhaupt rechtmäßig Hamburger Hoheitsgebiet geworden ist!“ Der Grünen-Politiker verweist auf entsprechende politische Auseinandersetzungen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 1961 hatten die Länder Hamburg und Niedersachsen per Staatsvertrag vereinbart, dass die Insel Neuwerk im Tausch mit Teilen des Cuxhavener Hafengebiets von Niedersachsen abgetreten wird. Der Hamburger SPD-Bürgermeister Nevermann feierte das Grundstücksgeschäft als „Raumsicherung für die Zukunft“. Allerdings ist dokumentiert, dass damals von Beamten des Bundesverkehrsministeriums erhebliche Zweifel angemeldet wurden, ob diese in „Geheimgesprächen“ vorbereitete Tauschaktion rechtmäßig war. Zum einen gab es unterschiedliche Ansichten darüber, welche Sandbänke in der Elbmündung Bundes- oder Landesgebiet waren. Zum anderen wurde darauf verwiesen, dass laut Grundgesetz die Verfahren über Änderungen des Gebietsbestandes der Länder der Zustimmung des Bundesrates und des Bundestages bedürfen. Diese Beteiligung habe es seinerzeit offenbar laut zeitgenössischer Berichterstattung jedoch nicht gegeben.
Wenzel: „Dazu gibt es viele Fragen. Wenn Hamburg in der aktuellen Auseinandersetzung wieder einmal die Anrainer brüskiert, dann wäre es doch interessant zu erfahren, ob sich dieses breitbeinige Auftreten überhaupt durch eine juristisch wasserfeste Rechtslage begründen lässt“. Der Grünen-Politiker wies auf die mehrfach gewechselte territoriale Zugehörigkeit Neuwerks hin. Durchgängig bestand jedoch die enge Verbindung mit Cuxhaven für die Versorgung mit Lebensmitteln, Energie, ärztlichen Dienstleistungen und die Wahrnehmung der Belange von Tourismus und Naturschutz. Und es sollte nicht vergessen werden, dass Hinrich-Wilhelm Kopf als erster Ministerpräsident in Hannover nach dem Krieg die wesentlichen Inhalte des Entwurfs der Landesverfassung auf Neuwerk verfasst hat. Niedersächsischer geht es kaum. Hamburg behandelt die Insel wie ein Faustpfand. Für Niedersachsen ist Neuwerk ein Stück Heimat!“, sagte der Grünen-Politiker.
Anfragen im Niedersächsischen Landtag und im Bundestag könnten nun für Aufklärung über das Zustandekommen des Staatsvertrages und die dabei erörterten oder auch ausgeklammerten politischen und juristischen Bedenken sorgen.
Rubrik: Bundesebene: Stefan Wenzel - Bundestagsabgeordneter
Rubrik: Themenschwerpunkte: Nordsee & Elbe & Weser
Grünen-Abgeordnete Wenzel und Viehoff mit scharfer Kritik an Hamburger Verklappungsplänen bei Scharhörn: Fachlich, politisch und juristisch unsinnig - „Hamburger Kehrtwende an der Elbe gefordert“
Wenzel: Kein Hamburger Hafenschlick nach Scharhörn – Keine korrekte Genehmigungsgrundlage – Immer größer, immer tiefer, immer unvernünftiger - Hamburg ein unbelehrbarer Nachbar?
Grünen-Bundestagsabgeordneter Stefan Wenzel fordert mehr Engagement für den Hafenausbau in Cuxhaven
Wenzel will durchgreifende Gefahrenabwehr in der Frachtschifffahrt
Newsletter Nr. 1
Weiterer Atomausstieg ist Meilenstein für Energiewende und Sicherheitsgewinn
2012 in Brokdorf//Cuxhaven_Gruppe
Stefan Wenzel, MdB, Wahlkreis Cuxhaven – Stade II zum Start der Arbeit in der Regierungsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen:
Stefan Wenzel - Statement zur Elbefähre
Grünen-Bundestagsabgeordneter Stefan Wenzel: Mit dem AKW Brokdorf geht ein „Symbol des Atomstaates“ vom Netz -- Nur 35 Jahre Strom – aber eine Million Jahre Altlast
Brokdorf - immer verbunden mit Widerstand, hier ein Foto aus 2008